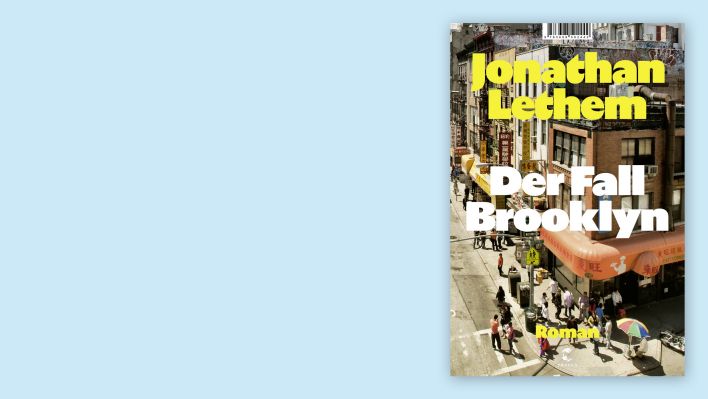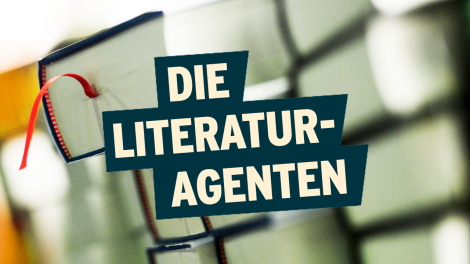Die Literaturagenten - Jonathan Lethem über "Der Fall Brooklyn"
Wer ist eigentlich schuld an der Gentrifikation? Also: welche Personen genau? Woher kann man wissen, wie man sich bei einem Straßenüberfall verhalten soll? Wie werden aus alltäglichen Vorfällen in der Nachbarschaft legendäre Geschichten? In seinem Roman "Der Fall Brooklyn" geht der Schriftsteller Jonathan Lethem den unsichtbaren Gesetzen und Strukturen nach, die Brooklyn zum berühmtesten Kiez der Welt gemacht haben. radioeins-Literaturagent Thomas Böhm sprachen mit Jonathan Lethem über seine unvergesslichen Figuren, verhängnisvolle Versäumnisse und darüber, wie man ein Stadtportrait als Hardboiled-Krimi aufzieht.
Thomas Böhm: Vor 20 Jahren erschien Ihr Brooklyn Roman „Die Festung der Einsamkeit“. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie wollten mit „Der Fall Brooklyn“ zurück zu Ihrem „Quellcode“ wollten. Sie geben dem Buch die Form einer „Investigation“. Der Ausdruck fällt oft im Buch. Was genau haben Sie gesucht?
Jonathan Lethem: Ich glaube, jeder hat das Gefühl, dass die eigene Kindheit, der Ort und die Umstände, unter denen man aufgewachsen ist, eine Art geheimnisvolle Geschichte sind. Ein Kind ist unschuldig und betritt eine Welt voller Komplikationen. Ich habe vor 20 Jahren „Die Festung der Einsamkeit“ als traditionelle Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Ein sehr attraktives Modell, um sich in die Lage des Kindes zu versetzen, das schaut, lernt und Erfahrungen aufnimmt, versucht, sie einzuordnen und zu verstehen. In diesem neuen Roman wollte ich einen größeren Blickwinkel gewinnen, ein umfassenderes Bild der Komplikationen zeichnen, die niemand allein jemals lösen kann. Und ich wollte zeigen, wie komplex kollektive Erfahrungen sind. Eine Stadt, ein Viertel, ein Ort wie Brooklyn ist geprägt von Widersprüchen und unvereinbaren Geschichten und Mysterien, die in gewisser Weise nie gelöst werden können, weil die unterschiedlichen Sichtweisen auf unterschiedliche Landschaften, unterschiedliche Möglichkeiten zielen.
Thomas Böhm: Wir kennen Sie als Meister des literarischen Pastice. Kennen Ihre Vorliebe für Genreliteratur. Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Buch über Brooklyn an den Stil von Hardboiled-Krimis anzulehnen?
Jonathan Lethem: Ich wollte unbedingt über den Ton des Hardboiled-Romans nachdenken, der für mich aus verschiedenen Quellen kommt. Er entspringt zum Teil einer fast schon europäischen Avantgarde-Idee. Und dann machten die Krimiautoren Raymond Chandler, Dashiell Hammett und einige andere daraus eine sehr bekannte, vielleicht sogar klischeehafte Art, über das amerikanische Leben zu sprechen, insbesondere über die Stadt und die Welt des Verbrechens. Aber diese Art des Sprechens wurde auch mit Straßengesprächen assoziiert, nicht-literarischen Gesprächen. Mit einem Stil, den es insbesondere in New York City während meiner Kindheit gab. Einen ausdrucksstarken, unorthodoxen, informellen und allgegenwärtigen Stil. Ein Stil, in dem die Leute sich übereinander lustig machten. Oder ihre Zuneigung zueinander ausdrücken. Es war die Sprache des Lebens - immer in Bewegung.
Ich wollte diesen Stil nicht nur verwenden, sondern ihn auch untersuchen. Er war Teil des Rätsels, das ich zu lösen versuchte: Was enthüllt diese Stimme und was kann sie verbergen? Was verbirgt sie? Welche Art von Trauma? Welche Art von Schmerz oder Verwirrung wurde unter den Teppich gekehrt?
Thomas Böhm: Wer erzählt da überhaupt?
Jonathan Lethem: Nun, ich würde zu viel verraten, wenn ich das direkt beantworten würde. Tatsächlich ist das zentrale Rätsel, mit dem sich dieses Buch beschäftigt, die Frage, wer solche Geschichten erzählen darf? Wer kann sich die Befugnis anmaßen, im Namen der kollektiven Erfahrung zu erzählen? Wer kann die Geschichte eines ganzen Viertels erzählen? Wer kann Brooklyns Geschichte erzählen? Das Buch ist also eine Art Selbstgespräch darüber, wer das Recht hat zu sprechen. Und in gewisser Weise ist diese Entdeckung oder dieser Untersuchungsprozess das zentrale erzählerische Rätsel, in das das Buch verstrickt ist.
Thomas Böhm: Gleich am Anfang des Buches gibt es eine Szene, bei der vier Jungen zu einem Hockeyspiel wollen. Aber sie müssen durch ein Viertel, dass von älteren, stärkeren Jungen für sich reklamiert wird. Die vier Jungen wollen die Stärkeren umgehen. Und dann... erfahren wir nicht, wie die Episode weitergeht. Sie bauen einen Cliffhanger in eine banale Kindheitsgeschichte. Welche Idee steckt dahinter?
Jonathan Lethem: Und das ist ja natürlich nur eine von mehreren Geschichten in diesem Buch. Es geht um einen kleinen Vorfall, der so weit ausufert, dass er das ganze Buch prägt, während man nach und nach Hinweise auf den Zusammenhang erhält. Die Idee dahinter ist, dass wir selbst aus den kleinsten Erlebnissen tolle Geschichten, Witze, Anekdoten oder auch gruselige Geschichten machen können, zum Beispiel von dem Tag, an dem ich dieses Verbrechen erlebt oder dieses Trauma erlitten habe. Aber um die wahre Bedeutung einer Geschichten zu verstehen, muss man die Welt um sie herum betrachten.
Thomas Böhm: Die Figuren in Ihrem Roman werden nicht bei ihren Taufnamen genannt. Sie bleiben anonym oder werden mit ihrem Rufnamen erwähnt. Mr. Clean, the Wheazer, the Screamaer. Warum benutzen sie nicht die "echten" Namen?
Jonathan Lethem: Ich habe im Laufe meiner Arbeit festgestellt, dass mich die Art und Weise, wie Menschen einander wahrnehmen und wie sie in einem Beziehungssystem agieren, sehr interessiert. Viel mehr als die typische Psychologie, die individuelle emotionale Entwicklung einer Figur. Mich interessiert, wie Menschen im System einer Straße, eines Viertels, eines Arbeitsplatzes oder einer Schule agieren. Sie betrachten einander kategorisch. Sie sehen Hautfarbe, Beruf, Alter, Verhalten oder Berufsbezeichnung. Und sie denken: „Okay, das ist diese Person.“ Sie agieren in Beziehung zueinander. Und so werden sie anhand ihrer Rolle in der Maschinerie beschrieben.
Thomas Böhm: Die Frau, die schreit ist eine faszinierende Figur. Irgendwie scheint sie die Einzige zu sein, die ihr Leiden an der Situation öffentlich macht. Leiden die anderen stumm?
Jonathan Lethem: Mir gefällt diese Beschreibung. Ich glaube, sie ist eine Art Ausruferin, eine Stadtschreierin. Ich weiß nicht, wie dieser Begriff im Deutschen lautet. Eigentlich ist es eine mittelalterliche Bezeichnung. Sie ist die Stimme des Unausgesprochenen. Sie ist diejenige, die das Trauma der Situation, die ungelösten, unvereinbaren Gefühle, zum Ausdruck bringt.
Thomas Böhm: In Amerika geht gerade ein unglaubliches Verbrechen vor sich. Es "Die Zerstörung der Demokratie" zu nennen, ist wohl noch zu kurz gegriffen. Wie sind die Verbrechen, die in ihrem Buch beschrieben werden, mit diesem Verbrechen verbunden?
Jonathan Lethem: Es ist natürlich eine beängstigende Zeit, die Nachrichten zu lesen und über die eigene Mitschuld nachzudenken. Unser Land erlebt eine Zeit der Angst vor seiner möglichen Zukunft. Und manche lösen das, indem sie andere terrorisieren. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich denke, das ist letztlich eine globale Realität. Das gilt für alle, denn wir sind ein System, eine Welt. Mein Buch schlägt einen Bogen zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. Es handelt von Menschen, die in Machtsystemen, Einflusssystemen leben. Der Begriff Gentrifizierung, um den es ja auch im Buch immer wieder geht, beschreibt, wie Banken und Immobilienmakler ein Viertel zu Veränderungen zwingen. Veränderungen, die die Bewohner zu kontrollieren hoffen. Aber natürlich haben sie nie die endgültige Kontrolle darüber. Vielleicht sagt dies etwas über die Beziehung des individuellen Lebens zu den historischen Kräften aus. Suchen Sie nach Orten, an denen Sie neue Perspektiven finden, neue Wege des Erzählens und einen neuen Zugang zum kollektiven Gedächtnis schaffen können.
Thomas Böhm: Müssen wir nicht genau das auf einer breiteren politischen Ebene tun: unsere alten Überzeugungen untersuchen und feststellen, wo diese nicht der Wahrheit entsprachen. Um dann neue Stimmen einzubeziehen, einen neuen Chor bilden?
Jonathan Lethem: Ich finde diesen Vorschlag sehr ansprechend; dass gewissenhaftes historisches Denken ein Weg ist, der populistischen Wut zu entkommen und unsere Lebensweise wirklich zu durchdenken. Für mich gehört es zum Verständnis der historischen Realität dazu, die Verwicklung des eigenen Landes in historische Tragödien zu erkennen. Die Deutschen haben hierbei vielleicht eine Vorreiterrolle eingenommen, während meine Gesellschaft sich bisher sehr zurückgehalten hat. Natürlich ist das nur eine Voraussetzung. Eine weitere ist politische Vorstellungskraft, der Glaube an Möglichkeiten. Denn der Populismus besteht darauf, dass wir bestimmte Möglichkeiten in unseren Gesellschaften ausschließen. Aber wir müssen auf die Kraft der Vorstellungskraft setzen, um diese Dinge zu verändern.