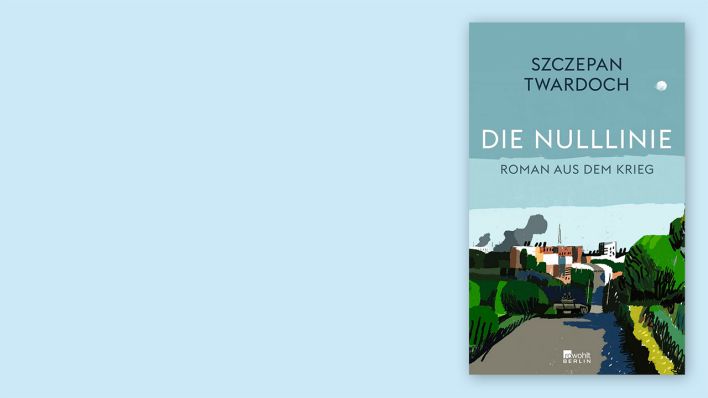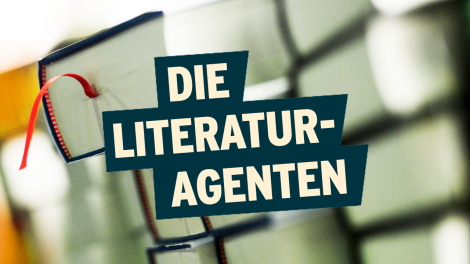Die Literaturagenten - Szczepan Twardoch über "Die Nulllinie"
Ein Mann, der sich den Kriegernamen "Koń" gegeben hat, zusammen mit einem anderen, der "Ratte" genannt wird. Die beiden hocken in einem schlecht geschützten Keller, irgendwo an der Front des Krieges in der Ukraine. Warum ist Koń, der in Polen aufgewachsen ist, in den Kampf gezogen? Wie erleben die Soldaten den Krieg? In "Die Nulllinie" erzählt der polnische Autor Szczepan Twardoch über den Alltag des Krieges, den er aus eigener Anschauung kennt. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Twardoch, der selbst wiederholt Material an die Front brachte, unterwegs mit Soldaten war und dabei selbst in Lebensgefahr geriet über seinen – so der Untertitel – "Roman aus dem Krieg". Das Interview fand statt, während Twardoch unterwegs war, um den Usedomer Literaturpreis 2025 entgegenzunehmen.
Thomas Böhm: Es heißt ja, Autoren brauchen Distanz, um über Ereignisse zu schreiben. Ihr Buch trägt den Untertitel "Roman aus dem Krieg". Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Distanz aufzugeben – "aus dem Krieg" zu schreiben?
Szczepan Twardoch: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Distanz aufgegeben habe. Dieser Roman beschreibt Dinge, die ich gesehen, erlebt und gehört habe. Er basiert zu einem gewissen Grad auf meinen eigenen Erfahrungen. Obwohl ich kein Soldat bin und nicht in diesem Krieg gekämpft habe, habe ich viel Zeit in den Schützengräben verbracht. Die Ereignisse, die ich beschreibe, sind mir nah. Andererseits war ich dort nur Gast. Ich kann kommen und gehen, wann immer ich will. Ich begann in Kiew zu schreiben. Als ich aus dem Donbass zurückkehrte, war ich so tief in all den Geschichten, die ich von den Soldaten gehört hatte. Ich setzte mich in ein Restaurant und begann in mein Notizbuch zu schreiben. Aber das war erst der Anfang. Das ganze Buch ist von meinem Büro aus geschrieben. Das verschaffte mir Distanz.
Thomas Böhm: Sie schreiben in einer Nachbemerkung, dass sie fiktiv schreiben mussten – also keine Reportage, sondern einen Roman, "um der Wahrheit so nah zu kommen", wie sie es vermögen. Welche Wahrheit meinen Sie?
Szczepan Twardoch: Das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich bin Romanautor. Seit 20 Jahren. Ich arbeite also mit den Werkzeugen, die ich am besten kenne. Das war ein Grund, mich für die Form des Romans zu entscheiden. Der zweite ist, dass viele meiner Charaktere auf realen Personen basieren. Wenn ich Sachbücher schreiben würde, müsste ich bei der Beschreibung viel vorsichtiger sein. Um ihnen nicht zu schaden. Nicht nur den Russen, sondern auch den Menschen innerhalb des ukrainischen Militärs. Die Fiktion ist der Schutzwall, mit dem ich meine Freunde schütze. Die Menschen, die ich kenne und denen ich nur Gutes wünsche. Es gibt noch einen dritten Grund. Nämlich den, dass ich fest davon überzeugt bin, dass der Roman eine sehr wichtige Errungenschaft unserer Zivilisation ist. Wie die Quantenphysik oder die gotische Kathedrale. Der Roman ist eine Form, die es uns Schreibenden ermöglicht, das Leben wahrheitsgetreu zu beschreiben. Vielstimmig. Ein Roman kann das Leben in all seiner Vielfalt, Tiefe und Komplexität beschreiben. Sachbücher haben ihre Grenzen. In Sachbüchern kann man das Innenleben der Figuren nicht beschreiben, weil man es einfach nicht kennt. Man kann sich nicht ausmalen, was sie fühlen. In einem Roman sollte man genau das tun.
Thomas Böhm: Es gibt in ihrem Buch Fakten, die mir so nicht bewusst waren. Z.B. dass viele der Kämpfer private Ausrüstung mitbringen, die Hauptfigur Kon hat sogar eine eigene Drohne finanziert. Oder dass Kolumbianer in Reihen der Ukrainer kämpfen, die von den kolumbianischen Drogenkartellen dorthin geschickt wurden, um zu Soldaten zu werden.
Szczepan Twardoch: Nun, einer von ihnen wurde von einem Kartell geschickt. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, ob sie wahr ist. Es ist einfach eine gute Geschichte, die ich gehört habe. Um auf Ihre Formatfrage zurückzukommen: Auch hier ermöglicht die Fiktion einen breiten Spielraum. Denn ich musste die Geschichte nicht bestätigen. Ich habe sie gehört, also konnte ich sie verwenden. Aber zurück zur Wahrheit! Die meisten Kolumbianer sind nur wegen des Geldes dort. So einfach ist das.
Thomas Böhm: Was ist Ihrer Meinung nach wichtig über diesen Krieg zu wissen, das heute nicht allgemein bekannt ist?
Szczepan Twardoch: Es ist ein Krieg, der in hohem Maße durch Crowdfunding finanziert wird. Nach meinem heutigen Kenntnisstand sind bis zu 80 % der Verluste, die dem Feind, den Russen, zugefügt werden, auf Drohnen zurückzuführen. Und bis vor Kurzem wurden alle Drohnen, jede einzelne Drohne, privat durch Crowdfunding finanziert, zum Beispiel von Leuten wie mir. Aber auch von der großen Zahl Freiwilliger, die zusammenarbeiteten, um die ukrainische Armee mit dem zu versorgen, was sie wirklich braucht. Ich weiß, dass das ukrainische Militär mit der Bereitstellung von FPV-Kampfdrohnen begonnen hat. Aufklärungsdrohnen aber, all diese Maviks, und Autos und alles andere, werden hingegen weiterhin durch Crowdfunding von Zivilisten, und von den Soldaten selbst finanziert. Das ist meiner Meinung nach wichtig, denn ich habe noch nie zuvor in der Geschichte von einem Krieg gehört, der so ablief.
Thomas Böhm: Das Buch beginnt mit einem Zitat aus der Illias. Darin geht es darum, dass Achill vor die Wahl gestellt wird: Entweder in den Krieg zu ziehen und so ewigen Nachruhm zu erlangen. Oder nach Hause zu gehen, auf den Ruhm zu verzichten, dafür aber ein langes Leben zu haben. Ist das die Wahl, die heute noch gültig ist. Die wohlmöglich die Attraktion des Krieges ausmacht: man kann dort "Ruhm" erlangen?
Bevor er antwortet, beschreibt Twardoch an dieser Stelle, dass er auf der Gegenfahrbahn der Autobahn A4 in Polen einen Konvoi von LKWs sieht. Auf denen stehen Panzer, die an die Ukrainische Front gebracht werden.
Szczepan Twardoch: Es gibt sehr berühmte Soldaten, und Ruhm ist eine sehr wichtige Währung im Krieg. denn als berühmter Soldat kann man diesen Ruhm gewissermaßen gegen Dinge eintauschen, die man braucht. Zum Beispiel Zugang zu teurer Unterstützung wie einem Artillerieangriff. Als berühmter Brigadekommandeur zieht man natürlich gute Soldaten an, denn gute Soldaten wollen unter einem guten Kommandeur dienen. Aber Ruhm muss man sich verdienen. Ruhm ist nicht etwas, das einfach in der militärischen Hierarchie liegt. Er kommt nicht mit den Streifen auf der Schulter. Man kann immer noch Sergeant sein, und trotzdem sehr berühmt sein, von den Obersten wie ein Gleichgestellter behandelt werden. Das kommt vor. Es herrscht eine andere, horizontalere, nicht vertikale Hierarchie im Militär. Aber das ist vielleicht eine andere Art von Ruhm, als Achilles meinte. Er meinte sicher den, wie er den Ratuschni-Brüdern zuteilgeworden ist. Der berühmtere der beiden war ein Dichter, ein sehr junger Dichter und Aktivist, der seit 2014 kämpfte. Er fiel, glaube ich, letztes Jahr. Die ganze Nation trauerte nach seinem Tod. Seine Beerdigung in Kiew war eine Massenveranstaltung. Tausende Menschen kamen, um ihm die Ehre zu erweisen. Er hatte einen Bruder der, glaube ich, vor zwei Monaten starb. Zurück blieb die Mutter, die beide Söhne im Krieg verlor und nun die Hüterin ihrer Erinnerung ist. Ja, sie taten, was Achilles tat. Sie erlangten ewigen Ruhm, ewige Berühmtheit. Aber sie verloren ihr Leben, sie verloren die ganze Welt. Sie verloren die Möglichkeit zu lieben, Kinder zu haben, Gedichte zu schreiben, Künstler zu sein, einfach alles. Sie verloren alles, aber erlangten ewigen Ruhm. War es ihre Entscheidung? Ich weiß es nicht. Sie akzeptierten die Möglichkeit zu sterben. Sie haben sich nicht vor der Einberufung gedrückt, sondern sich freiwillig gemeldet, weil sie kämpfen wollten. Sie haben die Möglichkeit des Todes in Kauf genommen, ihr Leben zu verlieren, um ihr Land zu verteidigen. Ich schätze, es war eine Art Wahl. Und die Mutter? Natürlich ist es eine Tragödie, aber andererseits sagt sie: "Ich habe sie so erzogen."
Thomas Böhm: Ihre Hauptfigur Koń ist ein Intellektueller aus Warschau. Er kennt das Nachdenken über den Krieg, das bis in die Antike zurückreicht. Er geht in den Krieg. Es gibt die Figur des Dima, der als Barmann in Berlin lebte und ein intensives Leben in den Nachtclubs führte. Auch Dima geht in den Krieg. Gibt es eine allgemeine Erklärung dafür, dass solche Männer in den Krieg ziehen – oder führen Sie vor, dass die Erklärung dafür bei jedem einzelnen individuell und nicht immer rational nachvollziehbar ist?
Szczepan Twardoch: Die meisten Soldaten, die ich getroffen habe, sind gegen den Krieg. Sie wollten ihn nicht. Sie kämpfen, weil sie müssen. Es ist nicht ihre Lebensart. Sie müssen diesen Krieg einfach führen, weil sie ein Land zu verteidigen haben. Und die Verteidigung des Landes ist keine abstrakte Idee. Es ist kein abstrakter Patriotismus. Denn sie verteidigen ganz reale und einfache Dinge, wie ihre Heimat. Sie verteidigen ihre Familie. Sie schützen ihre Familie vor Vergewaltigung, Mord und Massengrab. Denn das ist es, was die Russen üblicherweise tun, seit wir Russland kennen. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, ich bin mir absolut sicher, dass die Motivation von Soldat zu Soldat unterschiedlich ist. Und die Motivation kann sich mit der Zeit ändern. Denn der erste Impuls könnte die Verteidigung des Landes sein. Dann will man kämpfen, weil man seine Freunde nicht im Stich lassen will. Denn gemeinsamer Kampf schafft eine starke Bindung zwischen Menschen. Und ich denke, diese Art von Bindung ist etwas ganz Besonderes im Krieg. Ich würde sagen, es ist eine brüderliche Bindung zwischen Menschen, die täglich dem Tod ins Auge sehen, der Möglichkeit des Todes. So kämpft man immer weiter, weil man seine Freunde, seine Brüder, seine Kameraden nicht im Stich lassen kann. Es tut mir leid, ich weiß, das klingt alles klischeehaft und vielleicht ein bisschen peinlich oder banal. Aber genau darum geht es.
Thomas Böhm: Koń, ihre Hauptfigur befindet sich in einer Art Dialog. Mit wem führt er ihn und wie haben Sie diese Erzählweise gefunden?
Szczepan Twardoch: Sie haben Recht mit dem inneren Dialog. Man kann getrost sagen, dass sich die ganze Situation in Końs Kopf abspielt. Die innere Stimme, die ihn anspricht, ist die Stimme einer ihm wichtigen Person. Und das ist eine Trauerstimme. Die Stimme liefert auch die Erklärung, warum er in den Krieg gezogen ist, der nicht sein Krieg ist. Weil er, glaube ich, Erlösung sucht. Ob Erlösung überhaupt möglich ist, ist für ihn nicht einmal sicher. Ich versuche immer, eine Erzählstimme zu finden, die den beschriebenen Dingen entspricht. Dieser Krieg wird größtenteils aus der Vogelperspektive geführt. Durch die Drohnen. Ich denke, diese Distanz, die ich zwischen der Erzählung und den Protagonisten aufgebaut habe, entspricht in gewisser Weise dieser Vogelperspektive auf den Krieg aus der Drohnenperspektive. Das war mein Gefühl, als ich an diesem Roman arbeitete: Jemand blickt auf Koń von oben herab.
Thomas Böhm: Das Buch enthält keinen Appell, den Krieg, das Leiden zu beenden. Keine Perspektive, dass und wie der Krieg überhaupt enden könnte. Warum nicht?
Szczepan Twardoch: Weil ich kein Ende des Krieges in meiner gesamten Erfahrung vorkommt. Ich sehe keine Perspektive für ein Ende dieses Krieges. Ich habe keinen einzigen Soldaten getroffen, der über das Ende des Krieges gesprochen hätte. Wenn ich mit Soldaten spreche, höre ich immer die Stimme des spanischen Philosophen Santayana in meinem Kopf. In einem seiner Texte schrieb über den 11. November 1918 in London, als er junge englische Soldaten und Offiziere beobachte, die das Kriegsende feierten. Sie waren verwundet, erholten sich im Krankenhaus, hatten vom Waffenstillstand gehört und feierten. Santayana sagte: "Der Krieg wird niemals enden." Was er meinte, war, dass der Krieg für diese Männer niemals enden wird. Er schreibt, dass nur die Toten das Ende des Krieges gesehen haben. Ich glaube, er meint damit, dass es einen tiefgreifend beeinflusst, wenn man Teil dieser gewaltigen, schrecklichen Erfahrung des Kämpfens war, wenn man mittendrin war. Die Wirkung ist so groß, dass sie einen Menschen für immer verändert, so dass für immer dort im Krieg bleibt.
Thomas Böhm: Zum Schluss erlauben Sie eine persönliche Frage: Was ist ihr Antrieb, in diesem Krieg präsent zu sein. Hilfe zu liefern, bei den Soldaten zu sein?
Szczepan Twardoch: Nun, weil es von meinem Wohnort Pirogovice in Oberschlesien anderthalb Tage mit dem Auto zu den Schützengräben im Donbass sind. Nur anderthalb Tage. Dieser Krieg ist so nah an meinem Zuhause. Er ist so nah an der Grenze meines Landes. Er betrifft mich so sehr, dass ich ihn nicht ignorieren konnte. Ich verspürte diesen Drang zu helfen, zumindest auf diese bescheidene Art und Weise, die mir möglich ist, zum Beispiel durch Spendensammeln, den Kauf von Ausrüstung wie Autos, Drohnen, Zielfernrohren für Gewehre und so weiter. Einfach um bei diesem großartigen und zugleich edlen Bemühen zu helfen, Menschen zu verteidigen, die so leben wollen, wie sie leben wollen, und nicht auf eine Art und Weise, die ihnen aufgezwungen werden soll.